Skript - Elektrochemie
Einführung
Mit Hilfe dieses Skriptes sollen Sie sich das Thema Elektrochemie selbstständig erarbeiten. Selbstständig bedeutet wirklich SELBST und STÄNDIG.
Der Unterricht im klassischen Sinne hat aufgehört. Sie können Ihr eigenes Tempo bestimmen und sich Ihre eigenen Partner suchen. Sollte die Lehrkraft nicht da sein, haben Sie nun immer das Material um selbstständig zu arbeiten.
Die Lehrkraft soll Ihnen dabei als Berater zur Seite stehen. Wenn Sie Fragen haben oder auf Probleme stoßen, die Sie weder allein noch im Team lösen konnten, dann fragen Sie nach!
Für jedes Kapitel dieser Reihe ist angegeben, wie Sie vorgehen sollten. Die Vorüberlegungen sollen Ihnen helfen Wissen zu reaktivieren oder Wissenslücken zu schließen. Wenn Sie sich an die vorgegebenen Vorgehensweisen hallten, sollte es keine Probleme geben.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, warum die Lehrer so faul sein dürfen und Sie jetzt alles allein machen müssen. Der Grund ist recht einfach: die Lehrer haben alles bereits so vorbereitet, dass Sie sich intensiv mit einem Thema beschäftigen können. Dadurch bleibt es besser in Ihrem Gedächtnis. Sie lernen effektiver die Inhalte, verbessern Ihr eigenes Zeitmanagement und analysieren Ihre eigenen Fähig- und Fertigkeiten.
Symbole im Skript
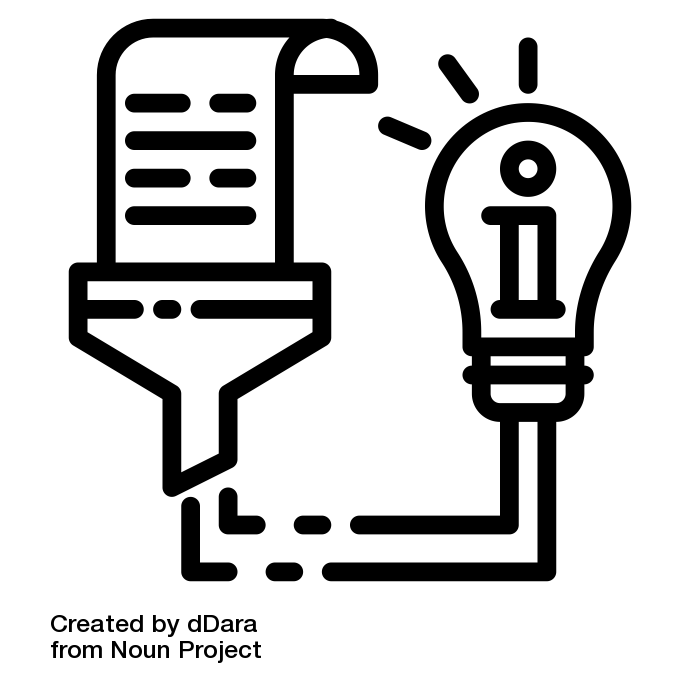
In diesen Texten finden Sie Erklärungen und Hintergründe!
Die Quellen finden Sie in den Fußnoten. Diese Quellen können Ihnen auch als Quizvorbereitung helfen.
Übrigens, nicht alle Quellen sind Wikipedia. Aber es ist eine nützliche und in Chemie akzeptierte Quelle.
Bild: Information by dDara from the Noun Project
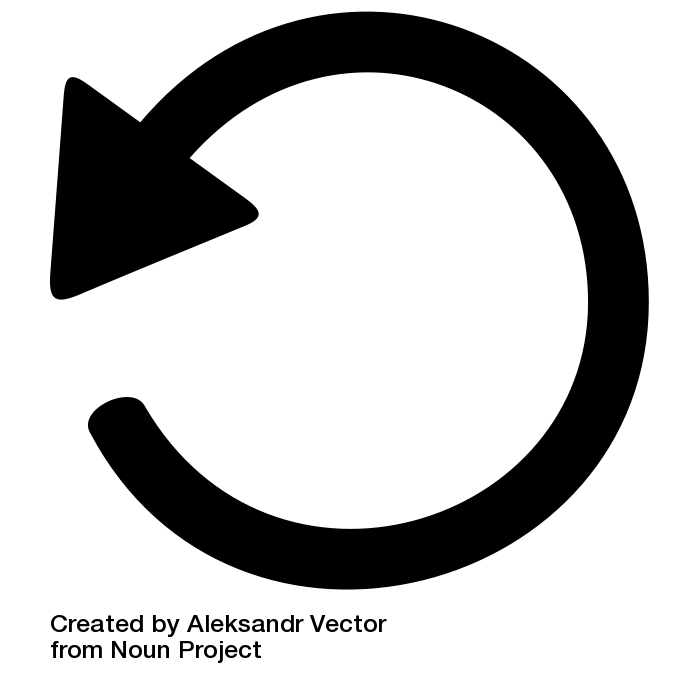
An diesen Stellen sollen Sie Ihr Wissen auffrischen!
Sie sollten die entsprechenden Themen schon vorher im (Chemie-)Unterricht behandelt
haben.
Falls nicht, arbeiten Sie Ihre Wissenslücken bitte selbstständig auf.
Bild: Arrow by Aleksandr Vector from the Noun Project
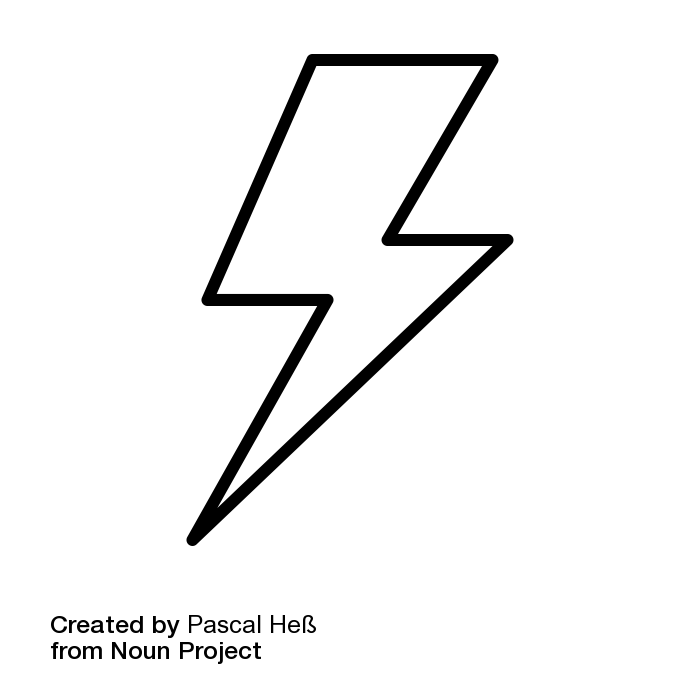
Es soll keine Langeweile aufkommen.
Wenn Sie mit den Aufträgen bereits fertig sind, während Ihre Gruppe noch arbeitet,
können Sie sich hier noch weiter in das Thema vertiefen.
Bild: thunder by Pascal Heß from the Noun Project
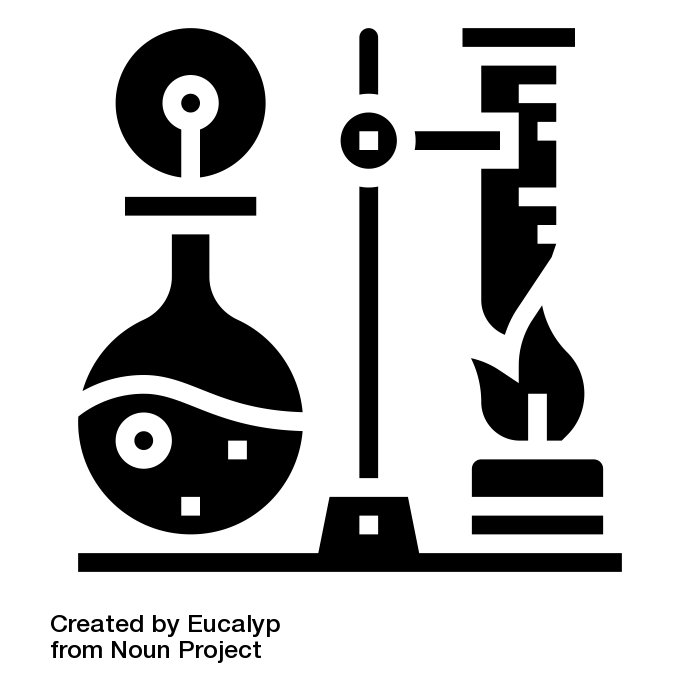
Dieses Symbol weißt immer auf eine Durchführung für ein Experiment hin.
Bild: Chemistry by Eucalyp from the Noun Project
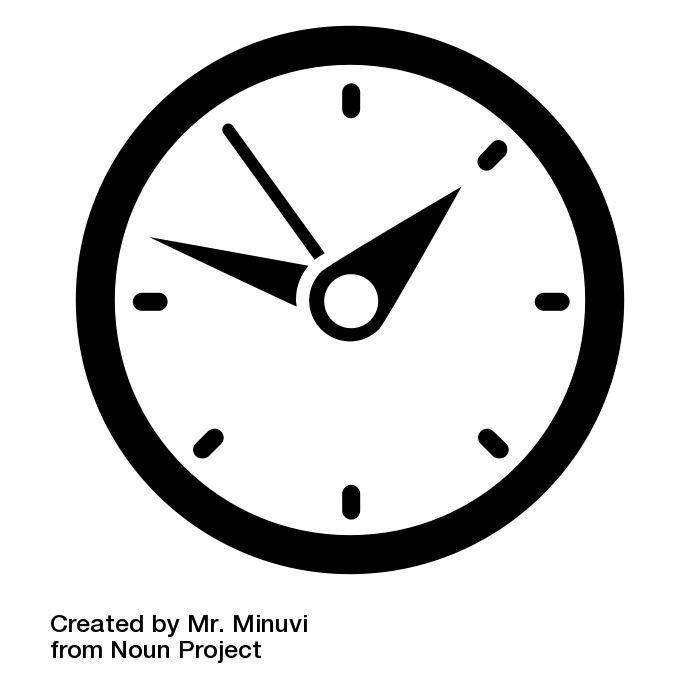
Das Zeitsymbol soll Ihnen zeigen, wie lange Sie für das jeweilige Kapitel brauchen sollten.
Diese Zeitangabe dient aber nur als Orientierung. Am Ende müssen Sie nur die Planung der Lehrkraft und Ihre eigene Zeitplanung beachten.
Bild: clock by Mr. Minuvi from the Noun Project
Bewertung
Die Bewertung im Semester erfolgt anhand von:
- min. 2 Tests
- 2 Protokollen
- Mitarbeit im Unterricht
- digitalem Portfolio
- ggf. Klausur
Auf Grund unvorhergesehener Umstände (z.B. Pandemie) kann sich diese Liste auch ändern. Bitte halten Sie mit Ihrer Lehrkraft Rücksprache.
Das digitale Portfolio
Das Portfolio ist ein Teil der Arbeit und Bewertung. Zum einen dient es der Sicherung und Sammlung aller Arbeitsergebnisse. Sie können und sollten in diesem Portfolio alles sammeln, was Sie an Materialien und Produkten selbst erarbeitetet haben. Die zweite Funktion des Portfolios ist die Darstellung Ihrer eigenen Entwicklung. Mit Hilfe des Portfolios belegen Sie Ihren Lernfortschritt und reflektieren Ihre Arbeitsergebnisse und Arbeitsweisen. Diese Reflexion sollte sich auf alle Arbeitsprozesse, wie z.B. Recherchen oder Gruppenarbeiten, beziehen. Die Selbstreflexion sollte unabhängig von den Arbeitsaufträgen der Lehrkraft erfolgen.
Darüber hinaus können Sie dieses Portfolio auch als Teil Ihrer zukünftigen Bewerbungsmappen nutzen. Ihr zukünftiger Arbeitgeber erlangt dadurch ein umfassenderes Bild von Ihnen. Sehen Sie das Portfolio also nicht nur als weiteren Schulhefter sondern auch als Selbstdarstellungsmöglichkeit.
Die Bewertung des Portfolios erfolgt zum Ende des jeweiligen Semesters und erfolgt mit Hilfe des gegebenen Bewertungsrasters.
Hilfreiche Fragen für die Reflexion
Falls Sie anfangs bei der Reflexion Probleme haben, können Sie sich erst einmal an diesen Fragen orientieren. Die Reflexion sollten Sie regelmäßig durchführen und als Fließtext ausformulieren.
- Habe ich die Zeit effektiv genutzt?
- Habe ich alle Aufträge gelöst?
- Habe ich alles verstanden?
- Habe ich gut allein gearbeitet?
- Habe ich gut in der Gruppe gearbeitet?
- Was kann ich in der nächsten Stunde besser machen?
Netzdiagramm zur Schnellreflexion
In Ihrem digitalen Portfolio sollen Sie Ihren Arbeits- und Lernprozess sinnvoll reflektieren um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden und dann umzusetzen. Dazu sollten Sie regelmäßig, also beispielsweise nach jedem Kapitel, eine Reflexion durchführen.
Dieses Netzdiagramm soll Ihnen dabei helfen. Sie können den Code für das Diagramm an die jeweilige Stelle in ihrem digitalen Portfolio kopieren und dort anpassen. Dadurch visualisieren Sie für sich ihren Fortschritt. Am Ende sollte das Netzdiagramm komplett gefüllt sein.
Zusätzlich sollten Sie die Reflexion in einem Fließtext ausformulieren. Das könnten Seite auch unterhalb des Diagramms in Ihrem Portfolio machen.
Bewertung des digitalen Portfolios
| Umsetzung digitales Portfolio (Gewicht: 1) | |
|---|---|
| 1BE | 2BE |
| HTML | schönes HTML |
| 3BE | 4BE |
| HTML,CSS | schönes HTML, schönes CSS (JavaScript) |
| Dokumentation (Gewicht: 2) | |
|---|---|
| 1BE | 2BE |
| Weniger als zur Hälfte erfüllt | Mehr als zur Hälfte erfüllt |
| 3BE | 4BE |
| Weitgehend erfüllt | Vollständig erfüllt |
| Reflexion (Gewicht: 3) | |
|---|---|
| 1BE | 2BE |
| Kaum Reflexionsfähigkeit erkennbar. Die Kurzreflexionen wurden selten genutzt oder das Semester wurde abschließend reflektiert oder die Reflexion wurde während des Semsters manchmal vorgenommen. | Reflexionsfähigkeit zum Teil erkennbar. Die Kurzreflexionen wurden selten genutzt. Das Semester wurde abschließend reflektiert oder die Reflexion wurde während des Semsters manchmal vorgenommen. |
| 3BE | 4BE |
| Gute Reflexionsfähigkeit erkennbar. Die Reflexion wurde mehrfach während des Semsters vorgenommen. Die Kurzreflexionen wurden genutzt. Das Semester wurde abschließend ergänzend reflektiert. | Sehr gute Reflexionsfähigkeit erkennbar. Die Reflexion wurde mehrfach während des Semsters vorgenommen. Die Kurzreflexionen wurden sinnvoll genutzt. Das Semester wurde abschließend ausführlich ergänzend und glaubhaft reflektiert. |
Die Dokumentation der Arbeit enthält z.B. die Lösungen zu den Arbeitsaufträgen, weitere (digitalisierte) Mitschriften, Quellen, Recherchen, gezeichnete oder ausgedruckte Bilder, Mind-Maps sowie verlinkte Videos und Webseiten. Dabei ist darauf zu achten, dass eine Sammlung von abfotografierten Heftseiten keine digitale Dokumentation im Sinne des digitalen Portfolios darstellt. Die durchgängige Reflexion beinhaltet die Arbeit in der Klasse, in der Gruppe, Einzelarbeit, die Reflexion des Erkenntnisstands etc. Die Lehrkraft kann in den Kategorien Dokumentation und Reflexion jeweils 1 bzw. 2BE von der Bewertung individuell abziehen.
Grundlagen
Um die Elektrochemie zu verstehen, braucht man noch einmal die Kenntnisse, die man schon in den Chemie- und Physikstunden in der 7. und 8.Klasse erarbeitet hat.
Wiederholung Grundlagen Chemie
Auftrag: Erarbeiten Sie sich die grundlegenden Begriffe und Konzepte, die für dieses Thema nötig sind.
- Erläutern Sie den Begriff 'Ladungsträger' und seine Bedeutung für den Stromfluss.
- Erläutern Sie den Begriff Oxidationszahlen! Erläutern Sie die wichtigsten Regeln zum Aufstellen der Oxidationszahlen!
- Erläutern Sie am Beispiel der Reaktion von Magnesium mit CO2 und der Bildung von Ammoniak aus den Elementen, die verschiedenen Konzepte hinter dem Begriff Redoxreaktion!
- Erklären Sie den Unterschied zwischen Stromfluss in Metallen, in wässrigen Salzlösungen und Salzschmelzen.
- Erläutern Sie den Begriff Dissoziation.
Input - Einfacher Redox-Begriff
Input - Erweiterter Redox-Begriff
Die galvanische Zelle
Die meisten modernen Batterien funktionieren immer noch nach den Prinzipien, die bereits im 18.Jahrhundert erforscht und beschrieben wurden: die galvanischen Zellen.
Am Ende dieses Kapitel sollen Sie ... :
- den Aufbau einer galvanischen Zelle beschreiben können.
- die Begriffe Halbzelle, Elektrolyt, Anode und Kathode erklären können
- die chemischen Hintergünde der galvanischen Zelle erläutern können.
- ein Daniell-Element bauen und die Funktionsweise erläutern können
Vorgehensweise:
- Bearbeiten Sie die Aufgaben zur galvanischen Zelle erst einmal allein.
- Verlgeichen Sie dann mit anderen Lernenden.
- Führen Sie die Experimente als Gruppe durch.
- Schreiben Sie ein eigenes Protokoll.
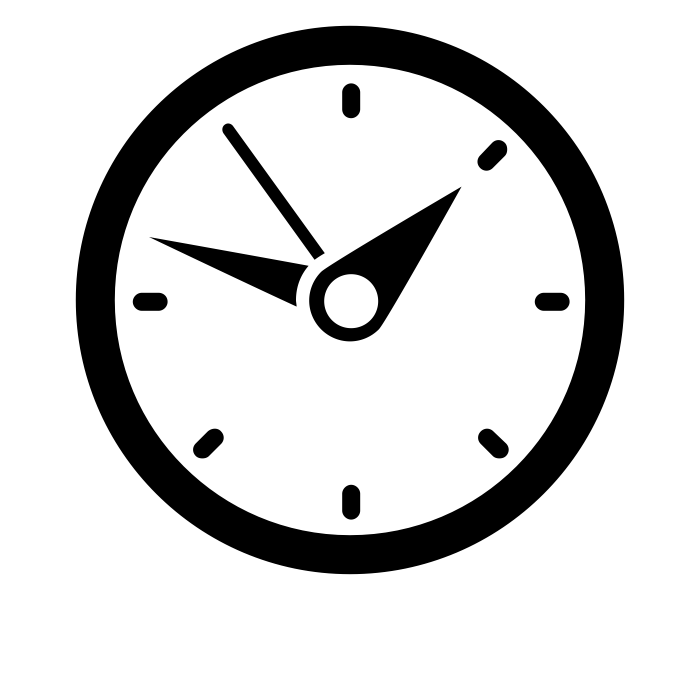
120min
Die Batterie
Eine Batterie zu bauen, also mit Hilfe chemischer Reaktionen Strom zu erzeugen, ist eigentlich gar nicht so schwer. Jedenfalls wenn es um das Prinzip geht.
Auftrag: Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise einer galvanischen Zelle.
- Erklären Sie den Unterschied zwischen chemischer und elektrischer Energie.
- Beschreiben und zeichnen Sie den allgemeinen Aufbau einer galvanischen Zelle.
- Definieren Sie dabei die Begriffe Halbzelle, Elektrolyt, Anode und Kathode.
- Erklären Sie die Begriffe Elektronendonator und Elektronenakzeptor.
- Kennzeichnen Sie die Fließrichtung der Elektronen in einem galvanischen Element.
- Erklären Sie die Funktion der Salzbrücke in galvanischen Elementen.
Auftrag: Bauen Sie eine spezielle galvanische Zelle: das Daniell-Element.
- Schreiben Sie ein ausführliches Protokoll. Deadline: mit Lehrkraft besprechen
- Dokumentieren Sie das Experiment so, dass Sie es auch in Ihr Portfolio einbinden können.
- Erläutern Sie in der Auswertung ausführlich die chemischen Hintergründe Ihrer Beobachtungen.
- Beantworten Sie auch die folgenden Fragen in Ihrer Auswertung:
- Erläutern Sie die Reaktionen am Plus- und Minuspol. Erklären Sie dabei die Begriffe Reduktion, Oxidation und Redoxreaktion. Erklären Sie, wie man Redoxgleichungen ausführlich aufstellt.
- Erklären Sie die elektrochemische Spannungsreihe. Erklären Sie dabei die Begriffe edle und unedle Metalle.
- Berechnen Sie die Spannung, die Sie theoretisch erzielen könnten. Erklären Sie, warum das nicht unbedingt praktisch umsetzbar ist.
Input - Die galvanische Zelle
Input - Edle und unedle Metalle
Der Akkumulator
In vielen Geräten steckt keine normale Batterie, sondern ein Akkumulator. Und auch im Rahmen der Energiewende spielen Akkumulatoren eine immer wichtigere Rolle.
Auftrag: Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise eines Akkumulators.
- Erklären Sie den Begriff reversible Redoxreaktion. Nennen Sie ein Anwendungsgebiet.
- Erklären Sie die Begriffe (galvanisches) Primär- und (galvanisches) Sekundärelement.
- Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise eines Blei-Akkumulators. Nennen Sie Anwendungsgebiete für diesen Akkumulatortyp und bewerten Sie seine Umweltverträglichkeit.
- Vergleichen Sie kurz den klassischen Bleiakku mit einem neuartigen Feststoffakkumulator.
Im Zuge der Energiewende wird von Kritikern oft der Begriff "Dunkelflaute" genutzt. Dagegen könnten Akkumulator und andere Techniken helfen.
Auftrag: Vergleichen Sie verschiedene Energiespeichersysteme.
- Erklären Sie kurz den Begriff Dunkelflaute.
- Erstellen Sie eine tabellarische Übersicht, in der Sie die folgenden Energiespeicher vergleichen:
- Batterie
- Akkumulator
- Redox-Flow-Zelle
- Graviationsakkumulator
- Vergleichen Sie folgende Kriterien kurz: Funktionsweise(kurz), Wiederverwertbarkeit, Nachhaltigkeit, zeitnahe Umsetzbarkeit
Die Elektrolyse
In Batterien wird chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt. Im Akkumulator wird dieser Prozess wieder umgekehrt. Das ist für die Nutzung von Energiequellen wie Sonne und Wind auch wichtig, da sie keine konstanten Energielieferanten sind, wie Atomkraftwerke. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten elektrische Energie zu nutzen: beispielsweise die durch die Wasserstoffelektolyse und Nutzung der Brennstoffzelle.
Am Ende dieses Kapitel sollen Sie ... :
- den Aufbau einer Elektrolysezelle am Beispiel des Hoffmannschen Zersetzungsapparates beschreiben können.
- den Aufbau und die Funktionsweise der Brennstoffzelle beschreiben und erklären können.
Vorgehensweise:
- Bearbeiten Sie die Aufgaben erst einmal allein.
- Verlgeichen Sie dann mit anderen Lernenden.
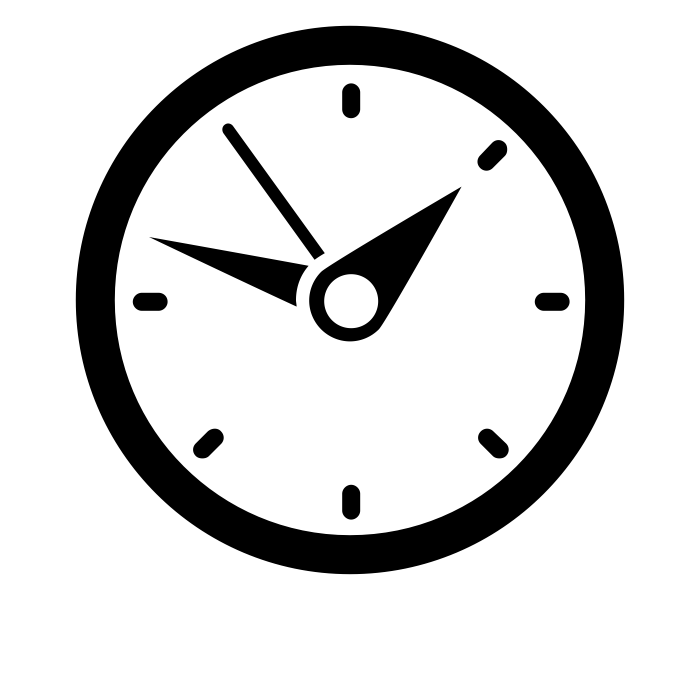
120min
Die Wasserelektrolyse
Die Herstellung von Wasserstoff ist im Augenblick ein viel diskutiertes Thema in der Energiepolitik. Sauberer Wasserstoff wird von manchen als simple Alternative zum Akkumulator oder fossilen Brennstoffen gesehen. Eine Möglichkeit den Wasserstoff herzustellen ist die Wasserelektrolyse.
Auftrag: Erläutern Sie das Prinzip der Elektrolyse am Beispiel des Hoffmannschen Zersetzungsapparates.
- Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise dieses Gerätes.
- Erläutern Sie an diesem Beispiel den Prozess der Elektrolyse.
- Vergleichen Sie die Funktion der Anode und Kathode (und Pluspol und Minuspol) im Vergleich zum galvanischen Element. Zeigen Sie, dass es sich dabei um eine Redoxreaktion handelt.
- In dem Zersetzungsapparat wird kein destilliertes Wasser sondern meistens ein Salz, Lauge oder Säurelösung verwendet. Erklären Sie die Verwendung.
- Erklären Sie den Begriff Zersetzungsspannung.
- Erklären Sie, warum man Platinelektroden im Zersetzungsapparat nutzt.
Die Brennstoffzelle
Um den Wasserstoff dann zu nutzen, kann man ihn wie Erdgas verbrennen oder mit Hilfe der Brennstoffzelle in elektrische Energie umwandeln.
Auftrag: Erläutern Sie die Funktionsweise der Brennstoffzelle.
- Erläutern Sie Aufbau und Funktionsweise der Brennstoffzelle.
- Erläutern Sie Umwandlung von chemischer Energie in elektrische Energie mit Hilfe von Reaktionsgleichungen.
- Recherchieren und erklären Sie, wie gut die Umwandlung von Energie erfolgt. Nutzen Sie dafür den Wirkungsgrad.
- Wasserstoffauto oder Elektroauto? Vergleichen und bewerten Sie beide Mobilitätskonzepte in Bezug auf ihre Effizienz bei der Umwandlung von Energie. Beschreiben Sie, wir bei beiden Antrieben Energie verloren geht.
Salzelektrolysen
Auftrag: Erläutern Sie die Vorgänge bei der Salzelektrolyse.
- Führen Sie das unten beschriebene Experiment durch und schreiben Sie ein ausführliches Protokoll.
- Erklären Sie in Ihrer Auswertung auch, welche Zersetzungsspannung man anlegen müsste. Gehen Sie in Ihrer Fehleranalyse darauf ein, warum dieser theoretische Wert im Experiment nicht ausreicht.
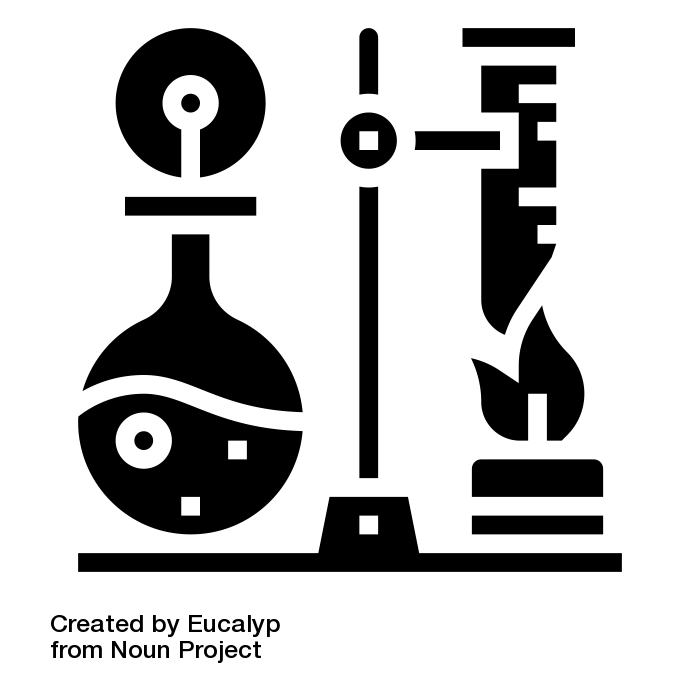
65 mg Kaliumiodid werden in 50 mL Wasser gelöst und die Lösung in die Petrischale gefüllt. Anschließend werden wenige Tropfen Phenolphthalein hinzugegeben und beide Kontakte der Batterie in die Lösung gehalten. Nach ca. 30 Sekunden wird an beiden Polen wenig Stärkelösung hinzugetropft. Man kann auch Stärkepulver hinzugeben.
Die Korrosion
Elektrochemie findet sich im Alltag leider nicht nur in Prozessen, die wir für Handys nutzen können. Ein negativer Effekt ist besipielsweise die Korrosion.
Am Ende dieses Kapitel sollen Sie ... :
- die chemischen Hintergründe der Korrosion erläutern können.
- die chemischen Hintergründe eines Lokalelementes erklären können.
- Maßnahmen zum Korrosionsschutz nennen und deren chemische Hintergründe erklären können.
Vorgehensweise:
- Bearbeiten Sie die Aufgaben erst einmal allein.
- Verlgeichen Sie dann mit anderen Lernenden.
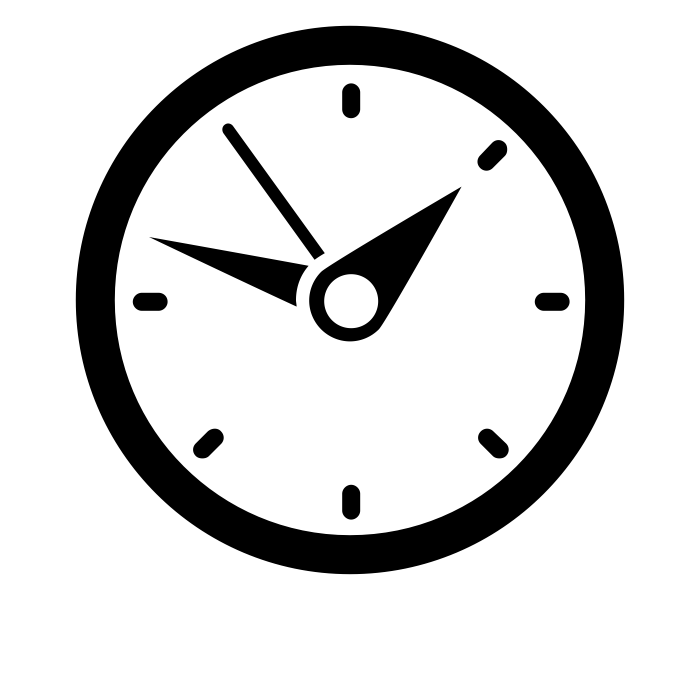
120min
Rosten, Lokalelement und Korrosionsschutz
Ein Beispiel für Korrosion kennt eigentlich man, wenn man schon einmal einen verrosteten Nagel oder ähnliches gesehen hat. Und auch viele andere Dinge können wegrosten. Was passiert da? Und wie kann man sich davor schützen?
Auftrag: Untersuchen Sie experimentell die unterschiedlichen elektrochemischen Prozesse der Korrosion.
- Führen Sie die Experimente durch und schreiben Sie ein ausführliches Protokoll. Es wird bewertet.
- Formulieren Sie für Experiment 1 eine Hypothese, was passieren wird.
- Beantworten Sie auch(!!) folgende Fragen als Teil der Auswertung.
- Zu Experiment 1/2:
- Erklären Sie den Begriff Korrosion und nennen Sie einige Beispiele für die verschiedenen Arten von Korrosion.
- Erläutern Sie die Begriffe aktiver und passiver Korrosionsschutz und nennen Sie Anwendungsbeispiele.
- Erläutern Sie den Begriff Opferanode und nennen Sie Anwendungsbeispiele.
- Erklären Sie, warum man die Metalle vor dem Experiment mit Schleifpapier behandelt.
- Zu Experiment 3:
- Erläutern Sie die chemischen Hintergründe und gehen Sie dabei auf den Begriff Lokalelement ein.
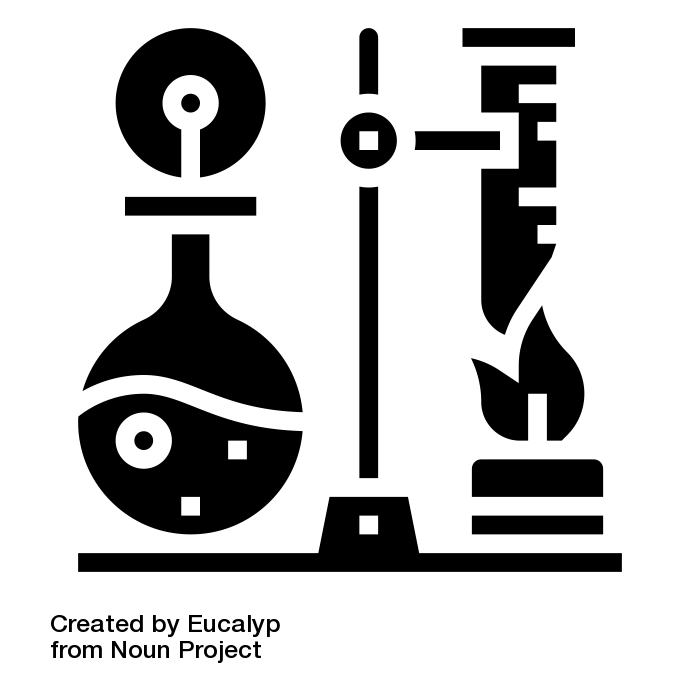
Experiment 1: 20 g Gelatine in 200ml Wasser einrühren und das Gemisch unter Rühren bis zum Sieden erhitzen, dann 2g Kaliumnitrat und 4 ml Phenolphthaleinlösung zugeben. Die Gelatinelösung teilen, ein Teil mit einer Spatelspitze rotem Blutlaugensalz (Lösung I), den anderen mit einer Spatelspitze gelbem Blutlaugensalz (Lösung II) versehen. 6 Eisennägel mit Sandpapier abschmirgeln, mit jeweils drei Nägeln wird wie folgt verfahren:
- 1. bleibt unbehandelt
- 2. in der Mitte 2cm lang fest mit Cu-Draht umwickeln,
- 3. mit 4 Zinkgranalien leitend in Kontakt bringen
Diese drei Eisennägel in die Petrischale legen und mit der Gelatine-Lösung I übergießen. Ein Parallelversuch wird genauso vorbereitet und mit Gelatinelösung II übergossen. Nach dem Abkühlen abdecken und mehrere Tage stehen lassen (nicht länger, sonst Schimmelbildung).
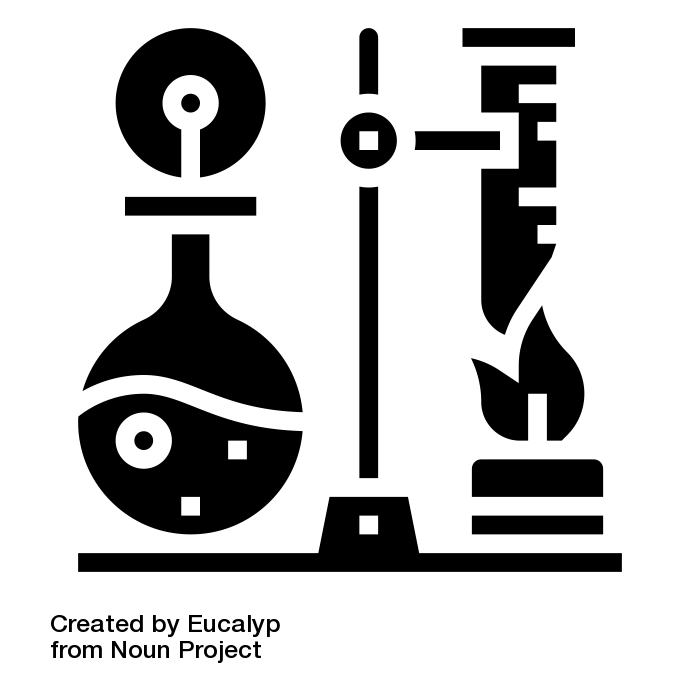
Experiment 2: 30 g Gelatine in 200ml Wasser einrühren und das Gemisch unter Rühren bis zum Sieden erhitzen, dann etwas Kochsalz und 10 ml Phenolphthaleinlösung zugeben. Die Gelatinelösung teilen, ein Teil mit einer Spatelspitze rotem Blutlaugensalz (Lösung I), den anderen unverändert lassen (Lösung II). 6 Eisennägel mit Sandpapier abschmirgeln, mit jeweils drei Nägeln wird wie folgt verfahren:
- 1. bleibt unbehandelt
- 2. in der Mitte 2cm lang fest mit Cu-Draht umwickeln,
- 3. mit Magnesiumband umwickeln.
Diese drei Eisennägel in die Petrischale legen und mit der Gelatine-Lösung I übergießen. Ein Parallelversuch wird genauso vorbereitet und mit Gelatinelösung II übergossen. Nach dem Abkühlen abdecken und mehrere Tage stehen lassen (nicht länger, sonst Schimmelbildung).
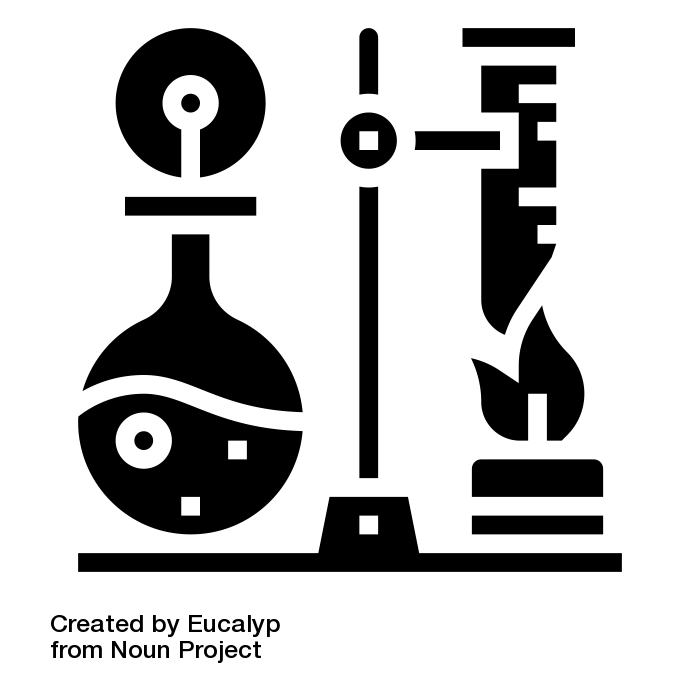
Experiment 3: Abgeschliffene (Schleifpapier) Zinkgranalien werden mit 10%iger Schwefelsäure oder konzentrierter Salzsäure (1M) übergossen. Beobachten Sie. Man berührt dann mit einem abgeschliffenen Kupferdraht ein Zinkstückchen.
Korrosion und Schutz im Alltag
Auftrag: Erläutern Sie wie Oma früher Silberbesteck gerreinigt hat... (und andere Haushaltstricks)
- Erklären warum Silber - schließlich ein Edelmetall - anläuft.
- Beschreiben Sie wie man angelaufenes Silber zu Omas Zeiten chemisch gereinigt hat. Tipp: Alufolie!
- Erläutern Sie die chemischen Vorgänge und gehen Sie dabei auch auf den Begriff Lokalelement ein.
- Nennen und erläutern Sie andere Beispiele für Lokalelemente.
- Erläutern Sie die Begriffe Sauerstoffkorrosion und Rosten. Erklären Sie dabei, warum man beim Nudelnkochen das Salz erst in das sprudelnde, kochende Wasser machen soll und nicht in das kalte, stille Wasser.
- Erklären Sie, warum Eisen rostet und Aluminium und Gold nicht.
Säurekorrosion
Auftrag: Erläutern Sie die chemischen Prozesse der Säurekorrosion.
- Erläutern Sie den Begriff Säurekorrosion an einem selbstgewählten Beispiel.